Das Jahr 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Jahres-Durchschnittstemperatur kletterte erstmals auf über 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Um die dringend notwendige Transformation einzuleiten, spielt auch gute Klimakommunikation eine Rolle.
Von Ann-Sophie Henne
Als am 15. April 2025 die Ergebnisse des Berichts zur Lage des Klimas in Europa von Copernicus und der WMO veröffentlicht worden sind, wurde zunächst die klassische Aufmerksamkeits-Maschinerie in Gang gesetzt: Medien berichteten, Politiker*innen äußerten sich erschrocken, Forschende bekräftigten, wie dringlich die Situation zu bewerten sei.
Tatsächlich sind die Ergebnisse des Berichts alarmierend. Der europäische Kontinent erhitzt sich von allen Kontinenten am schnellsten, seit den 1980er Jahren doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Eine Durchschnittstemperatur von 10,69°C hat das Jahr 2024 zum wärmsten jemals in Europa gemacht. Gleichzeitig war es im Westen Europas zu feucht, was sich fatal auf die Ernte auswirkte. Der Report listet als Folge zudem eine Vielzahl von Stürmen, Extremniederschlägen, Hitzewellen und Waldbränden auf. Die Schäden schätzten die Forschenden auf mehr als 18 Milliarden Euro.

Wo findet das Klima angesichts der Vielzahl an geopolitischen Brandherden, Inflation und einer allgemeinen Unsicherheit im gesellschaftlichen Diskurs eigentlich noch statt?
Copernicus Report: Weckruf oder Weiter-so?
Doch die politische Aufmerksamkeit für das Thema war schnell wieder vorüber. Womöglich lag der Fokus, wie die Tagesschau vermutete, mehr auf Debatten zum Krieg in der Ukraine, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Drei Monate später stehen wir vor dieser Frage: Wo findet das Klima angesichts der Vielzahl an geopolitischen Brandherden, Inflation und einer allgemeinen Unsicherheit im gesellschaftlichen Diskurs eigentlich noch statt?
Während Klima- und Umweltfragen bei der Europawahl 2019 noch das ausschlaggebendste Thema für die Wahlentscheidung war, mussten sie sich 2024 mit Platz vier begnügen. Wichtiger waren die Themen Friedenssicherung (26 %), Soziale Sicherheit (23 %) und Zuwanderung (17 %). Das Spannende daran: Jedes einzelne dieser Themen steht in einem engen Verhältnis zur Klimakrise.
Kriege, die aus Interesse an Öl und anderen fossilen Ressourcen geführt werden, sind nicht förderlich für den Faktor Friedenssicherung.
Wirtschaftliche Instabilität, die in veralteten fossilen Geschäftsfeldern begründet liegt, sowie Preissteigerungen, die uns Verbraucher*innen treffen, weil sich die Bundesregierung in der Energieversorgung abhängig von Autokratien gemacht hat, wirken sich negativ auf die soziale Sicherheit aus. Nicht zuletzt könnte sich, wer sich um das Thema Zuwanderung sorgt, auch dafür einsetzen, dass die Klimakrise als eine maßgebliche Fluchtursache ausgeschlossen werden kann.
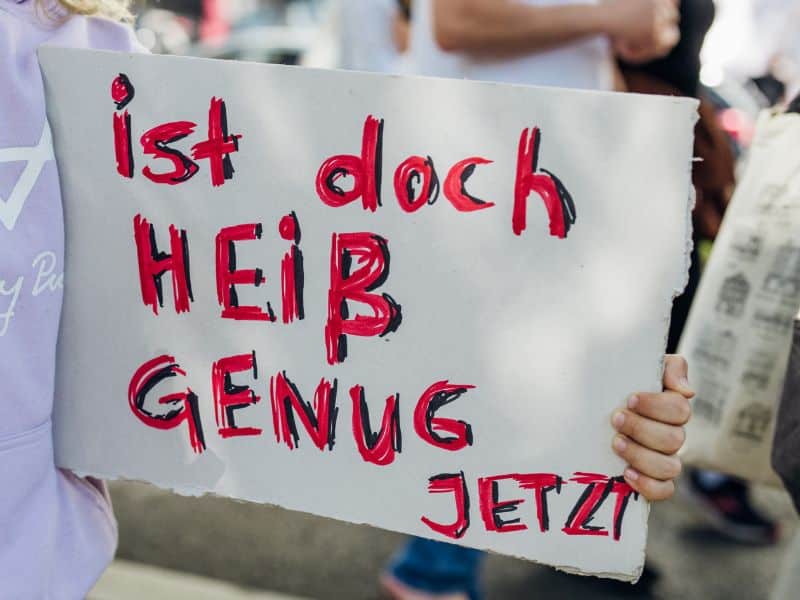
Was passiert, wenn wir nicht handeln?
Die Klimakrise ist somit auf vielschichtige Art und Weise mit anderen Krisen verknüpft – und vor allem mit den Krisen, mit denen sich die Menschen in Deutschland aktuellen Studien zufolge am meisten beschäftigen. Gleichzeitig können Klima- und Biodiversitätskrise bis zum Ende des Jahrhunderts zu ganz anderen Notständen führen, die uns laut Meinungsbarometern aktuell (bislang) weniger beschäftigen: Medikamenten-, Wasser- und Nahrungsknappheit, globale Kriege um Ressourcen und das Ende der menschlichen Zivilisation, wie wir sie kennen.
Um diese Risiken zu begrenzen, sind umfassende Klima- und Umweltschutzmaßnahmen möglich, die aktuell allerdings kaum Zustimmung in der deutschen Bevölkerung haben. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ipos zufolge sind nur noch zwei von fünf Bundesbürger*innen der Ansicht, dass Deutschland mehr gegen den Klimawandel tun sollte. Damit liegt die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich auf dem letzten Platz aller 32 befragten Länder.
Medien in der Klimakrise
Die Rolle der Medien ist entscheidend, um die Klimakrise nicht nur als temporäre Schlagzeile, sondern als permanente Herausforderung im öffentlichen Diskurs zu verankern. Eine kontinuierliche und tiefgreifende Berichterstattung trägt maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines schnellen und entschlossenen Handelns aufrechtzuerhalten.
Einige Hinweise deuten darauf hin, dass die Berichterstattung über die Klimakrise in diesen Jahren möglicherweise hinter (unbestreitbar wichtigen) geopolitischen und wirtschaftlichen Themen zurücktrat. Ob sich diese Vermutung bewahrheitet, müssen detaillierte Medienanalysen klären. Diese könnten aufzeigen, ob und wie sich der Fokus verändert hat und welche Faktoren dazu beigetragen haben. Unabhängig von der Quantität der Berichterstattung stellt sich außerdem die Frage, wie über die Klimakrise berichtet wird.

Strategien für effektive Klimakommunikation
Entscheidend ist hierbei nicht nur, das Bewusstsein für die Probleme zu stärken, sondern auch, Handlungsoptionen aufzuzeigen. Denn wenn ausschließlich über das Problem berichtet und die Zukunft als Katastrophe skizziert wird, kann das die Tendenz zur Folge haben, entsprechende Informationen zu vermeiden, zu vernachlässigen, zu bagatellisieren oder sogar zu leugnen.
Das Projekt Klimafakten der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation verlinkt auf seiner Webseite Best Practice Beispiele für gelungene Klimakommunikation, die nicht nur journalistische Angebote mitdenkt, sondern auch Computerspiele, Apps, Kunstprojekte, kommunale Klima-Lobbyarbeit und vieles mehr.
In einem Handbuch führen die Projektmacher außerdem auf, wie wirkungsvoll über das Klima gesprochen werden kann. Dabei wird beispielsweise geraten, den Klimawandel konkret zu machen, Geschichten zu erzählen und Wissenschaftsjargon und Katastrophismus zu vermeiden. Zu Beginn sollten Medienschaffende demnach auch ihre eigenen Einstellungen und Impulse hinterfragen und potenzielle Denkschwächen und Biases neutralisieren.
Zusammen mit dem Verein KLIMA° vor acht setzt sich die GLS Bank dafür ein, dass das Klima in die Primetime kommt. Der Wunsch ist, eine regelmäßige Sendung zur besten Sendezeit zu etablieren.
Was uns Hoffnung gibt
Mit nachhaltig.kritisch machen wir, Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling und Annika Le Large, seit Anfang 2019 Klimajournalismus auf Instagram. Was sich in dieser Zeit in unserem Bewusstsein und dem unserer Community verändert hat, ist enorm.
2019 war Fridays for Future gerade im Begriff, eine globale Bewegung zu werden. Heute gibt es in der “For Future”-Bewegung über 300 Gruppen unterschiedlichster Berufsfelder, die sich in ihrem Bereich für eine gerechte Klimawende einsetzen – darunter Psycholog*innen, Jurist*innen, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Wissenschaftler*innen, Lehrer*innen und Architekt*innen. In dieser Zeit haben sich zudem viele weitere aktivistische Gruppierungen gegründet.
Während 2019 unter dem Hashtag #Nachhaltigkeit fast ausschließlich ästhetisch aussehende Konsumgüter in die Kamera gehalten wurden, ist heute ein Großteil der klimabewussten Menschen auf Instagram konsumkritisch und Greenwashing-aware. Damals konnte man journalistische Angebote im deutschsprachigen Raum, die sich ausschließlich mit Klimathemen befasst haben, an einer Hand abzählen – heute gibt es viele sehr gute, sogar in großen Medienhäusern wie der TAZ und dem WDR.
Ein Blick zurück kann Hoffnung schenken
Während damals vor allem Beiträge über individuelle Lebensentwürfe und deren Auswirkung auf die CO2-Emissionen trendeten, liegt das allgemeine Bewusstsein mittlerweile klar auf der Systemebene. Wie muss sich unser Wirtschafts-, Finanz- und Ernährungssystem verändern? Wie sieht eine umfassende Energie- und Mobilitätswende aus? Wie können wir uns besser organisieren und welche Hebel haben wir, um große Veränderungen zu bewirken? Wie kann all das sozial und inklusiv vonstattengehen? Mit diesen Fragen dürfen wir uns mittlerweile fast jeden Tag beschäftigen. Die Fortschritte der letzten sechs Jahre zeigen sich nicht nur in unserer Instagram Bubble. Es tut gut, sich ab und zu die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Meilensteine bewusst zu machen. Denn die gibt es. Millionen von Menschen waren für Klima- und Klimagerechtigkeit auf den Straßen. Der Kohleausstieg wurde beschlossen und das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Klimaschutz im Grundgesetz verankert ist. Auf EU-Ebene wurde der European Green Deal eingeführt. Auf den Klimakonferenzen in Glasgow und Sharm el Sheik wurden weitere Schritte für Ausgleichszahlungen an den Globalen Süden erkämpft. Viele dieser Schritte sind nicht ausreichend und wurden im Nachgang von Lobbys und konservativen Parteien verwässert. Doch dass es sie gibt, ist ein Schritt in die richtige Richtung
Warum Weitermachen wichtig ist: Selbstwirksamkeit in der Klimakrise
Was uns bei nachhaltig.kritisch außerdem hilft, mit aktuellen Unsicherheiten zurechtzukommen, ist es, als Klimajournalist*innen aktiv zu sein, in unseren Recherchen der Krise ein Gesicht zu geben und sie damit greifbarer zu machen. Wir lieben es, mit unserer Community in den Austausch zu kommen und immer wieder festzustellen, dass wir nicht allein sind. Diese Bewältigungsstrategien decken sich auch mit den Erkenntnissen aus der Psychologie: Selbst aktiv zu werden und das Gefühl zu haben, mit seinen Handlungen etwas bewirken zu können, ist demnach das beste Mittel, das wir haben, um Gefühle wie Angst und Hilflosigkeit loszuwerden.
Es kann “verlockend” sein, sich auf das zu konzentrieren, was schiefläuft und in Gefühlen der Hoffnungslosigkeit zu versinken. Doch gerade jetzt ist es wichtig, dass wir nicht in Apathie verfallen. Dass wir wach sind, dass wir uns zusammenschließen, dass wir gegen Entwicklungen protestieren, mit denen wir nicht einverstanden sind.
Denn eins ist klar:
Diese Krise zeichnet sich durch Naturgesetze aus, die durch Verdrängung, halbgare politische Maßnahmen und schleppende globale Verhandlungen nicht verschwinden werden. Leider.


Zur Autorin
Ann-Sophie Henne hat International Business und Multimedia & Autorschaft studiert und während des Masterstudiums 2019 das journalistische Projekt nachhaltig.kritisch mitgegründet. Seitdem beschäftigt sie sich täglich mit der Klimakrise – insbesondere mit der gesellschaftspolitischen Dimension – und schreibt Beiträge für den Instagram-Kanal, mit dem das Projekt monatlich Hunderttausende Menschen erreicht. Seit 2021 co-hosted sie außerdem den nachhaltig.kritisch-Podcast, 2023 hat sie gemeinsam mit ihren Kolleg*innen Robin Jüngling und Annika Le Large ihr erstes Sachbuch veröffentlicht. Für ihre Arbeit bei nachhaltig.kritisch hat das Team mehrere Journalisten- und Nachhaltigkeitspreise gewonnen.
Foto: Elisa Schmidt

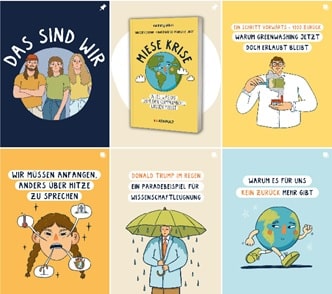
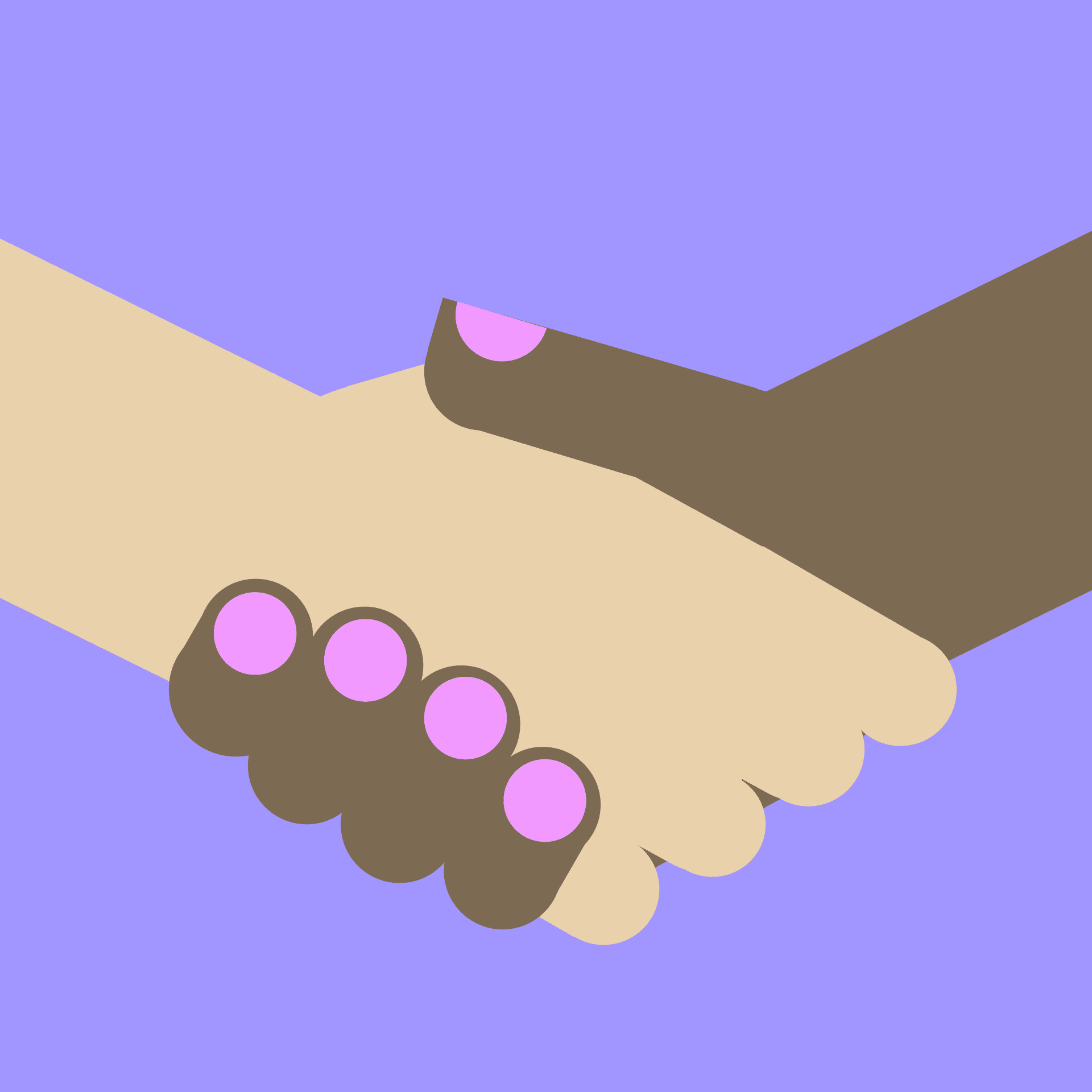



Schreibe einen Kommentar