Louisa Schneider, Klimajournalistin und Moderatorin war auf der COP 30 in Belém, Brasilien und schildert ihre Eindrücke.
Hier auf der COP 30 – der 30. Weltklimakonferenz – wird nicht nur über die Klimakrise gesprochen, man spürt sie. Die Hitze drückt jeden Tag in Belém. In der Mittagszeit brennt die Sonne so stark, dass ich kaum länger als ein paar Minuten draußen stehen kann, immerzu suche ich nach Schatten oder einem Unterschlupf. Und die Hitze von außen macht auch vor den riesigen Konferenzzelten der COP 30 nicht halt. Die Klimaanlagen sind nicht so leistungsstark und überall verteilt, dass es die Hallen wirklich herunterkühlt – und das steht den meisten Menschen mit dicken Schweißperlen auch ins Gesicht geschrieben. Es ist einfach viel zu heiß. Und wenn die Hitze mal nachlässt, dann meist nur, weil der Himmel aufreißt und der Amazonasregen in Sturzbächen niedergeht. Hier, am Tor zum größten Regenwald der Erde, wird klar: Hier ist Klima nicht ein Meta-Thema, sondern gelebte Realität.
Für mich ist es die erste COP – und es ist überwältigend. Fast 200 Staaten sind hier vertreten, jeder mit seinem eigenen Pavillon, seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Interessen. Es ist, als würde die ganze Welt für zwei Wochen in einem Mikrokosmos zusammenkommen. Man trifft Menschen, die man bisher nur aus Artikeln oder von Social Media kennt, hört Stimmen aus allen Teilen der Erde – und merkt doch: Wir alle stehen vor derselben Frage: Wie wollen wir leben, wenn alles, was uns trägt, ins Wanken gerät?
Zwischen Vernetzung und Verantwortung
Die COP ist wie ein riesiges Netz. Es geht darum, sich zu verbinden – mit NGOs, Aktivist*innen, indigenen Gemeinschaften, Journalist*innen, Politiker*innen. Aber dieses Netz knüpft sich nicht von selbst. Jede Begegnung, jedes Gespräch muss geplant, abgestimmt, koordiniert werden – zwischen all den Terminen, Panels, Meetings. Und trotzdem: Wenn es gelingt, entsteht etwas Besonderes.
Ich habe hier viel Zeit mit indigenen Organisationen aus dem Amazonas verbracht, mit Graswurzelbewegungen, die seit Jahren um ihre Rechte kämpfen. Viele dieser Menschen sind jung – und sie bringen eine Kraft und Klarheit mit, die mich tief beeindruckt. Sie sprechen nicht nur über Klimaziele, sondern über Gerechtigkeit, über Würde, über Überleben.
Warum junge Menschen hier sein müssen
Die Klimakrise ist keine ferne Zukunft, sie ist unsere Gegenwart – und sie trifft unsere junge Generation am härtesten. Deshalb ist die COP so wichtig für junge Menschen: weil wir unsere Stimmen, unsere Forderungen, unsere Perspektiven einbringen müssen. Hier vor Ort wird deutlich, wie viel Kraft in der Zivilgesellschaft steckt. Junge Menschen organisieren Demos, Aktionen, Side-Events, sie fordern politische Konsequenzen – und sie halten die Hoffnung aufrecht, dass Wandel noch möglich ist.

Zwischen Hoffnung und Frustration
Natürlich spürt man hier auch die Müdigkeit. Dreißig Weltklimakonferenzen – und wir sind noch immer dabei, die 1,5-Grad-Grenze zu reißen, selbst die glücklichsten Prognosen zeigen, wir rasen auf eine 2,8 Grad heißere Welt zu. Und was das bedeutet, kann und möchte sich niemand so wirklich ausmalen.
Viele junge Menschen sind wütend. Andere kommen gar nicht mehr. Sie haben das Vertrauen verloren, dass in den „shiny halls“ der großen Verhandlungsräume tatsächlich Entscheidungen fallen, die dem Ernst der Lage gerecht werden.
Und doch: Wer hier ist, bleibt. Nicht, weil man glaubt, dass alles gut wird. Sondern weil man weiß, dass nichts besser wird, wenn man aufgibt. Denn trotz aller Frustration ist die COP auch ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Atmens, des Wiederaufstehens.
Louisa Schneider ist gelernte Klimajournalistin, Moderatorin und Storytellerin. Auf Social Media, auf den Straßen und als Speakerin auf Bühnen klärt sie über die Klimakrise auf.
Was die COP besonders macht
Für mich ist die COP 30 kein Ort des Optimismus, sondern der Verantwortung. Hier sieht man, wie eng Klima, Gerechtigkeit und Machtfragen verwoben sind. Hier spürt man, dass es nicht reicht, über Emissionen zu reden, wenn man nicht auch über Ausbeutung, Kolonialismus und soziale Ungleichheit spricht.
Aber hier lernt man auch: Hoffnung ist kein Zustand. Sie ist eine Praxis. Und jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes kleine Aufstehen gegen die Ohnmacht ist ein Teil davon.

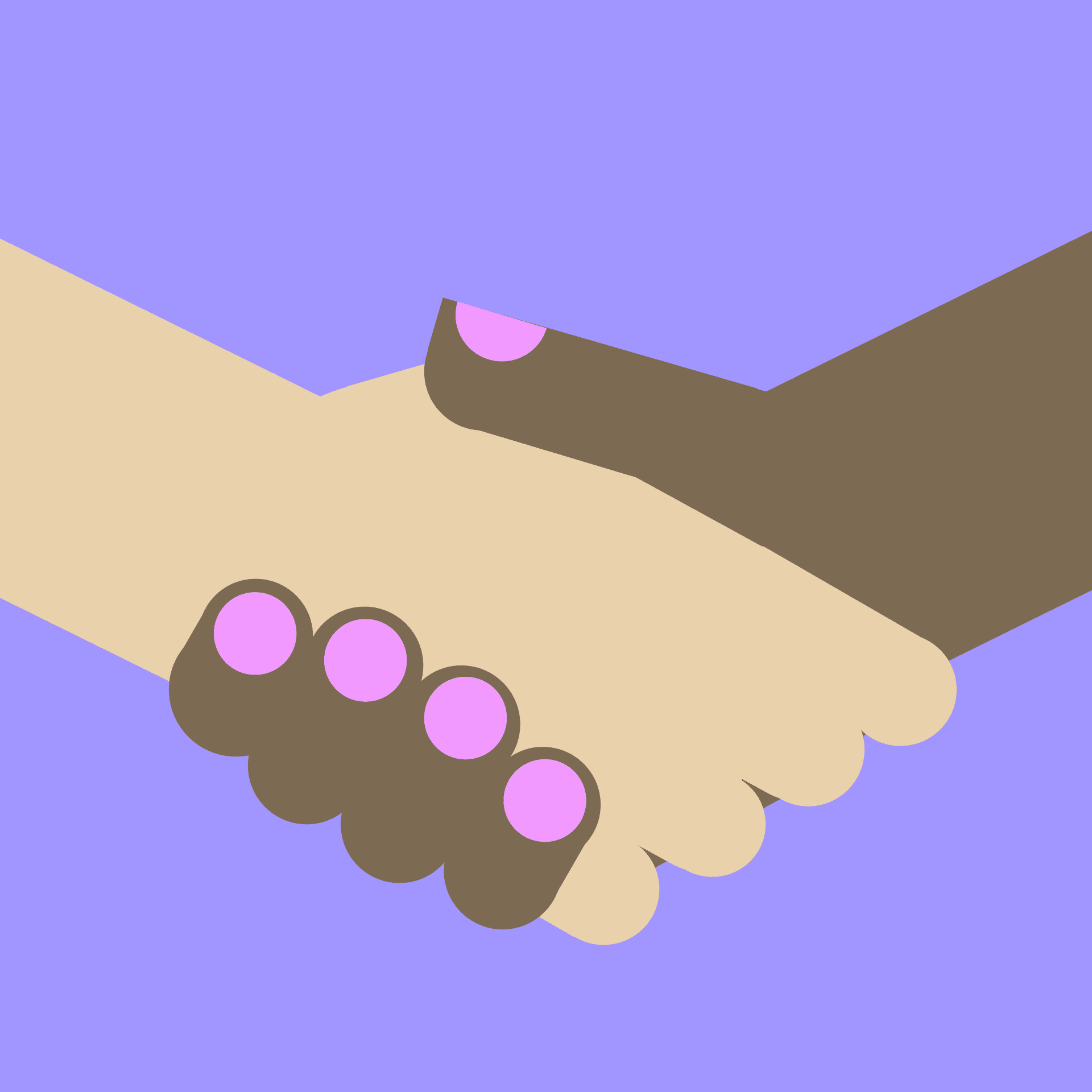



Schreibe einen Kommentar