In Deutschland entstehen immer mehr Photovoltaik-Anlagen. Der erzeugte Strom sorgt aber immer häufiger für Überschüsse, die das Netz nicht verkraften kann. Negative Strompreise sind die Folge. Doch jetzt ändert sich etwas.
Die Energiewende muss Tempo aufnehmen
Vor lauter Zeitenwende ist in den vergangenen Wochen eine andere bedeutende Wende etwas in den Hintergrund gerückt: die Energiewende. Das ist bedauerlich, denn die Energiewende muss Tempo aufnehmen, um die Klimakrise abzumildern.
Immerhin geht es voran: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag der Stromanteil aus erneuerbaren Energiequellen am insgesamt in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom 2024 bei 59,4 Prozent. Ein neuer Höchstwert. Im Jahr zuvor waren es noch 56 Prozent.
„Lange Zeit war Strom aus erneuerbaren Energiequellen ein Nischenprodukt, doch inzwischen erfolgt der Ausbau sehr dynamisch“, kommentiert Christian Marcks, Branchenkoordinator Erneuerbare Energien bei der GLS Bank, die Entwicklung.
Der wichtigste erneuerbare Energieträger ist Windkraft, sie sorgt für gut die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Gleichzeitig boomt seit einiger Zeit die Photovoltaik (PV). Die Stromeinspeisung aus dieser Energiequelle stieg laut Destatis 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10,4 Prozent, während sie bei der Windkraft leicht zurückging. Dies war der höchste Anteil an Strom aus Photovoltaik für ein Gesamtjahr seit Beginn der Erhebung vor sieben Jahren.
457 Stunden mit negativen Strompreisen
Immer mehr Strom aus Photovoltaik, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Leider gab es in diesem Zusammenhang aber auch eine schlechte Nachricht: Im vergangenen Jahr waren die Strompreise in insgesamt 457 Stunden – 19 Tage –, negativ. So häufig wie noch nie. Negativ heißt: Wer seinen Strom abgeben wollte, musste dafür zahlen. Der Grund: ein Überangebot an Strom, verursacht auch durch die zunehmende Erzeugung und Einspeisung von Solarstrom.
Dazu muss man wissen: Das Stromnetz muss – das hat physikalische Gründe – zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen sein. Es muss also stets so viel Strom eingespeist werden, wie entnommen wird. Man kann nicht einfach an sonnigen Tagen, an denen besonders viel Strom aus Photovoltaik produziert wird, diesen Strom ins Netz leiten, denn das würde für Instabilität sorgen. Doch wohin mit dem Strom?
Infobox: Strompreise
2024 kostete eine Kilowattstunde Strom einen privaten Haushalt durchschnittlich 41,59 Cent. 43,5 Prozent davon, also fast die Hälfte, wurde für die Beschaffung und den Vertrieb des Stromes fällig, inklusive Marge des Anbieters (18,10 Cent). 31,8 Prozent (13,22 Cent) des durchschnittlichen Strompreises entfielen auf Netzentgelte. Die übrigen 24,7 Prozent (10,27 Cent) mussten für Steuern, weitere Abgaben und Umlagen aufgewendet werden. Die Strompreise schwanken natürlich ständig, abhängig vom jeweils aktuellen Angebot und der momentanen Nachfrage. 2024 gab es in insgesamt 457 Stunden sogar negative Strompreise, weil das Angebot die Nachfrage übertraf. Die meisten Haushalte haben einen Vertrag mit fixen Preisen für den Strom. Es gibt aber auch variable und dynamische Stromtarife; seit diesem Jahr sind alle Stromversorger verpflichtet, solche Tarife anzubieten. Voraussetzung für einen dynamischen Tarif, der es einem ermöglicht, Geld zu sparen: ein intelligenter Stromzähler.
Änderung des Energiewirtschaftsrechts
Vergleichsweise still und leise – übertönt vom Getöse rund um die Migrationsdebatte –, brachte der alte Bundestag in den ersten Wochen des Jahres wichtige energiepolitische Gesetzesänderungen auf den Weg. Zum Beispiel das „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen“. Es trat am 25. Februar in Kraft. Das Gesetz reagiert auf die Herausforderungen, die sich aus den zunehmenden Stromspitzen im Netz ergeben. Kurz gesagt: Für die Stunden, in denen zu viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen für negative Preise sorgt, erhalten neu errichtete PV-Anlagen keine staatlich geförderte Einspeisevergütung mehr. Allerdings ist eine Kompensation vorgesehen: Die Zeit, in der die Förderung ausfällt, wird an den vereinbarten Förderzeitraum angehängt. Außerdem sollen die Betreiber*innen von PV-Anlagen ihren Strom künftig leichter vermarkten können.
Flankierend soll das Gesamtsystem so ertüchtigt werden, dass Netzbetreibende auch kleinere Anlagen besser steuern, sprich: in Überschusszeiten abregeln können.
„Es ist natürlich bitter, eigentlich gewünschten Strom aus erneuerbaren Quellen nicht einzuspeisen, wenn der Klimawandel gleichzeitig erfordert, dass dieser Stromanteil so schnell wie möglich steigt“, bedauert Christian Marcks. „Leider wurde viel zu lange verzögert, System und Netz für Erneuerbare als vorherrschende Erzeugungsquelle anzupassen.“
Es ist natürlich bitter, eigentlich gewünschten Strom aus erneuerbaren Quellen nicht einzuspeisen, wenn der Klimawandel gleichzeitig erfordert, dass dieser Stromanteil so schnell wie möglich steigt.
Christian Marcks
Infobox: Einspeisevergütung
Wer eine Photovoltaik-Anlage betreibt und einen Teil des erzeugten Stroms oder die gesamte Menge ins öffentliche Netz einspeist, erhält dafür eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), auch Einspeisevergütung genannt. Bei größeren Anlagen mit einer Maximalleistung von 40 bis 100 Kilowatt-Peak, die zwischen Februar und Ende Juli 2025 in Betrieb gehen, liegt die Vergütung beispielsweise bei 5,62 Cent pro Kilowattstunde bei Teileinspeisung und 10,56 Cent bei Volleinspeisung. Die Vergütung gilt für 20 Jahre.

Stromsystem soll flexibler werden
Was nach Ansicht vieler Fachleute fehlt, ist Flexibilität – auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. „Einerseits verhindern feste Netzentgelte eine flexible Nachfrage von Großabnehmern wie zum Beispiel Industrieunternehmen“, beobachtet der Energieexperte der GLS Bank. „Andererseits hemmen regulatorische Anforderungen des Staates derzeit noch immer den Ausbau von Speichern, wo es sinnvoll wäre.“ Immerhin: „Das kommt jetzt alles langsam in Gang.“
In der schönen neuen Energiewelt sähe es dann so aus, dass bei allen PV-Anlagen digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter, zum Einsatz kämen. Darüber ließen sie sich steuern – und abriegeln. Auch alle Stromabnehmenden würden solche Smart Meter einsetzen. Damit wäre die digitale Voraussetzung für flexible Stromverträge geschaffen. Man würde dann zu Zeiten, in denen der Strom billig ist, mehr verbrauchen, und Strom sparen, wenn die Preise hoch sind. Es gäbe mehr Anreize für Abnehmende sowie Einspeisende und damit mehr Dynamik; Angebot und Nachfrage könnten sich angleichen, das wiederum würde zur Netzstabilität beitragen.
Netzentgelte
Das Netzentgelt ist eine Gebühr, die jeder Netznutzende, der Strom oder Gas durch das Versorgungsnetz leitet, an den Netzbetreiber zahlen muss. Diese Gebühr ist ein Teil des Strom- oder Gaspreises. Mit den Entgelten finanzieren die Netzbetreiber die Kosten für den Betrieb der Netze, für deren Instandhaltung sowie den Ausbau der Netzinfrastruktur.
Das Netzentgelt wird von der Bundesnetzagentur reguliert, weil Strom- und Gasnetze natürliche Monopole sind und sich die Höhe des Entgelts daher nicht im freien Wettbewerb bilden kann.
Die Entgelte für die Nutzung des Stromnetzes machten für Haushaltskunden im vergangenen Jahr über 30 Prozent des Strompreises aus, zuvor war es rund ein Viertel. Gewerbe- und Industrieunternehmen werden häufig weniger stark belastet.
Immer mehr Batteriespeicher in Deutschland
Problematisch bleibt die Variante, überflüssigen Strom aus PV-Anlagen besser nicht zu produzieren, um negative Preise zu verhindern. Besser wäre es, diesen Strom trotzdem zu produzieren – und zwischenzuspeichern.
2024 stieg die installierte PV-Leistung in Deutschland auf knapp 100 Gigawatt, 16 Gigawatt mehr als im Jahr davor. Dem stehen aber deutlich weniger Speicherkapazitäten gegenüber. Nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW) waren 2024 in Deutschland mehr als 1,8 Millionen Speicher mit einer Kapazität von rund 19 Gigawattstunden installiert. Die Lücke ist groß, könnte aber sinken, denn offenbar gibt es gerade einen Boom bei Speicheranlagen. Dem BSW zufolge gingen vergangenes Jahr 600.000 neue Batteriespeicher an den Start, darunter nicht nur Heim-, sondern auch Gewerbe- und Großspeicher.
„Wir begrüßen die Entwicklung, es könnte aber noch schneller gehen“, sagt Christian Marcks. Die GLS Bank trägt dazu bei. Seit 2021 befasst sie sich intensiv mit dem Thema Energiespeicher und unterstützt Projekte als Finanzierungspartnerin. Allein 2024 hat die GLS Bank vier kleinere Energiespeichersysteme mit einer Nennleistung von rund sechs Megawatt finanziert.
Wir begrüßen die Entwicklung, es könnte aber noch schneller gehen.
Christian Marcks
GLS Bank finanziert derzeit größten Batteriespeicher
Und ein ungewöhnlich großes: Das deutsch-norwegische Unternehmen ECO STOR errichtet in der Nähe von Flensburg eine Anlage mit einer installierten Leistung von knapp über 100 Megawatt und einer Speicherkapazität von 238 Megawattstunden. Im zweiten Quartal 2025 soll sie in Betrieb gehen und Strom aus erneuerbaren Quellen zwischenspeichern. Es handelt sich nach Unternehmensangaben um den bisher größten Batteriespeicher in Deutschland.
In morgendlichen und abendlichen Spitzen der Stromnachfrage soll der Strom aus Windkraft und PV-Anlagen dann in das öffentliche Netz eingespeist werden. Rechnerisch können damit, heißt es von ECO STOR, rund 170.000 Mehrpersonen-Haushalte für jeweils zwei Stunden morgens und abends mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden. „Großbatteriespeicher sind zukunftweisende Infrastruktur“, sagt Christian Marks, „und ein ganz wesentlicher Baustein für eine gelingende Energiewende.“
Das brauchen wir von der Politik!
Als Bank der Zukunft – sozial-ökologisch seit 1974 – engagieren wir uns für eine lebenswerte Welt. Wir tun das ganz konkret in unseren sechs Branchen, in denen wir Kredite vergeben und Finanzierungen möglich machen. So haben wir sehr klare Vorstellungen davon, wie eine ökologisch und sozial gerechte Wirtschaftsweise aussehen kann. Für die Branche Erneuerbare Energien erklärt Dir Christian Marcks, was in diesem Bereich wichtig und wünschenswert für Deutschland ist.
Wir fordern von der neuen Bundesregierung, die Digitalisierung der Netze zu entbürokratisieren und alle Speichertechnologien dauerhaft von Netzentgelten zu befreien.
Christian Marcks

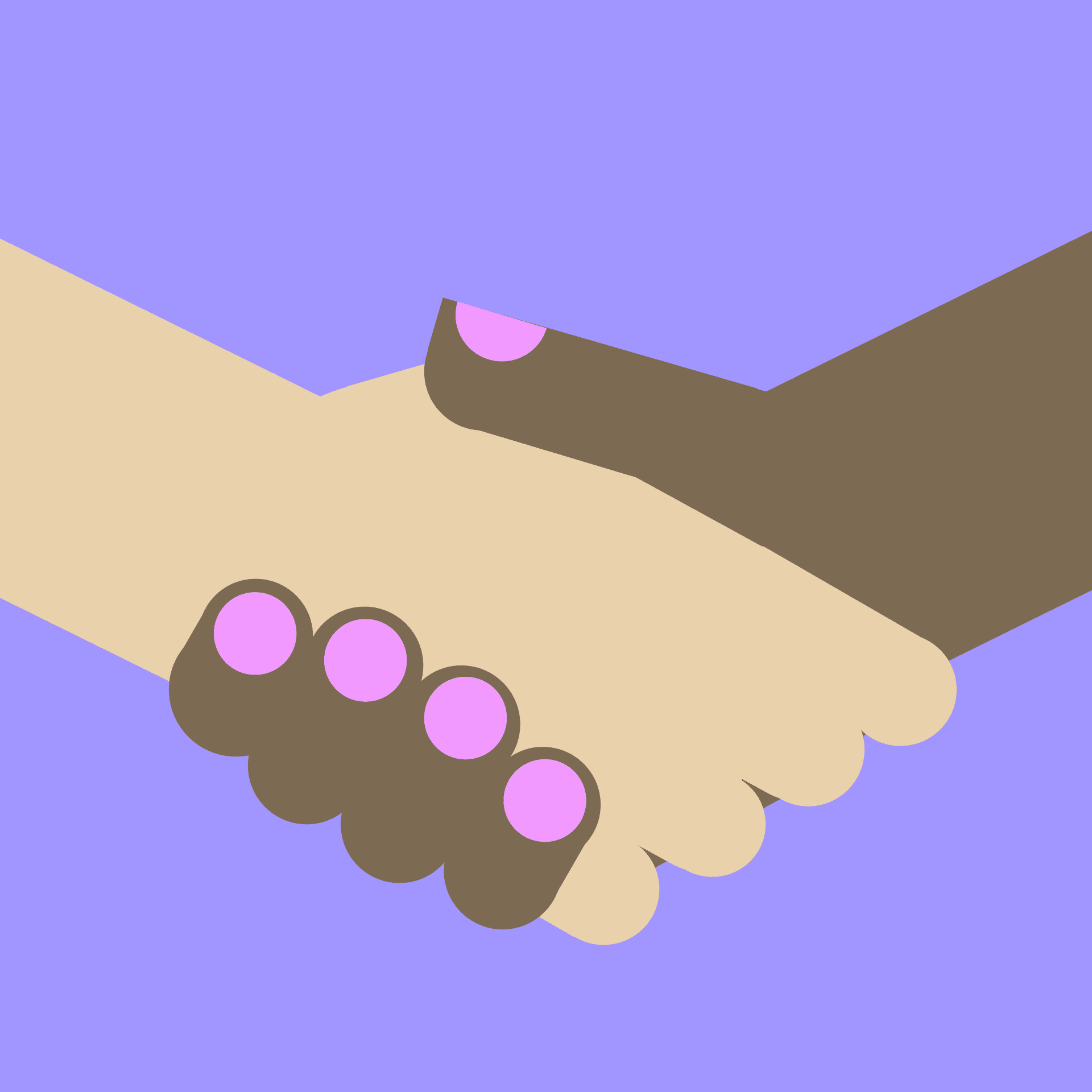



Schreibe einen Kommentar